Das Wichtigste auf einen Blick
- Viele Frauen stellen ihre eigenen Bedürfnisse zurück – nicht aus Schwäche, sondern aus Loyalität, Fürsorge oder Angst vor Ablehnung.
- Die drei häufigsten Gefühle, die uns blockieren, klar für uns einzustehen, sind: Wut, Schuld und Angst – oft unbewusst, aber wirksam.
- Wut signalisiert verletzte Grenzen – wird sie unterdrückt, wandelt sie sich in Erschöpfung, Reizbarkeit oder Rückzug.
- Schuldgefühle entstehen oft aus erlernten Mustern – nicht aus echtem Fehlverhalten. Emotionskompetenz hilft, zwischen beidem zu unterscheiden.
- Angst schützt uns, aber sie darf nicht entscheiden. Mut beginnt nicht mit Angstfreiheit, sondern mit Selbstbindung.
- Emotionskompetenz bedeutet: Gefühle erkennen, benennen und bewusst regulieren – nicht kontrollieren, sondern führen.
Die letzten Monate waren anstrengend – Teammitglieder fielen aus, Projekte stellten sich um, und eine neue Kollegin benötigte viel Einarbeitung.
An einem Freitag fragt ihr Vorgesetzter sie spontan, ob sie am Wochenende einen Notdienst übernehmen würde.
„Es wäre nur dieses eine Mal“, sagte er.
Miriam spürt sofort einen inneren Widerstand.
Sie hatte sich fest vorgenommen, endlich zur Ruhe zu kommen.
Kein Laptop, kein Diensthandy, nicht ständig auf Abruf sein.
Aber dann sagt sie:
„Ja, ich mach’s.“
Und ärgert sich – nicht über den Chef.
Sondern über sich selbst.
Nicht, weil sie es nicht schafft.
Sondern, weil sie sich übergangen hat.
Weil sie – mal wieder – funktioniert hat,
obwohl ihr Inneres längst auf Rot stand.
Viele Frauen, die beruflich und privat viel Verantwortung tragen,
haben über Jahre gelernt, sich selbst zurückzustellen.
Nicht aus Selbstaufgabe.
Sondern aus Fürsorge.
Aus Pflichtgefühl.
Aus dem Wunsch, niemandem zur Last zu fallen.
Genau das macht es so tückisch:
Die Gründe fühlen sich ehrenwert an.
Aber der Preis ist hoch –
wenn du dich selbst dabei vergisst.
Denn jedes übergangene Nein, jede heruntergeschluckte Wut, jede versteckte Angst trennt dich ein kleines Stück von dir selbst.
Bis du irgendwann nur noch funktionierst, aber dich nicht mehr spürst.
Der erste Schritt zurück zu dir beginnt damit, ehrlich zu betrachten, welche inneren Kräfte dich davon abhalten, klar für dich einzustehen.
Genau dort setzen wir jetzt an.
2. Wut – die Kraft, die wir nicht spüren dürfen
Wut hat ein Imageproblem, besonders für Frauen.
Man hält sie für unweiblich, unkontrolliert, unprofessionell.
Viele von uns haben gelernt:
Wütend sein ist gefährlich.
Wütend sein ist peinlich.
Wütend sein ist falsch.
Daher wird Wut leise.
Sie wandert nach innen.
Sie zeigt sich nicht mehr als klare Grenze –
sondern als ständige Anspannung, als Gereiztheit, als Erschöpfung.
Dabei ist Wut – psychologisch betrachtet – eine gesunde, sogar überlebenswichtige Emotion.
Sie zeigt uns, wenn etwas nicht stimmt.
Wenn eine Grenze verletzt wird.
Wenn etwas zu viel ist, zu nah, zu übergriffig.
Wut ist ein Signal für Selbstschutz,
aber nur, wenn wir ihr zuhören.
Was passiert, wenn wir sie unterdrücken?
Oft wandelt sie sich.
In Schuldgefühle.
In Selbstzweifel.
Oder in Perfektionismus – als Versuch, den Schmerz zu kontrollieren.
Viele Frauen sagen:
„Ich bin gar kein wütender Typ.“
Oder: „Ich kann gar nicht wütend sein.“
Doch wenn wir vorsichtig hinschauen, liegt sie darunter:
Die leise, alte, gut vergrabene Wut.
Darüber, nicht gehört worden zu sein.
Darüber, immer stark sein zu müssen.
Darüber, dass niemand fragt, wie es dir wirklich geht.
Diese Wut ist nicht destruktiv.
Sie ist aufrichtig.
Sie ist die Stimme eines Anteils,
der gesehen werden will.
Wut muss nicht laut sein, um klar zu sein.
Sie muss aber ihren Platz bekommen.
Sonst nimmt sie ihn sich – durch Körpersymptome, durch Rückzug, durch Leere.
3. Schuld – der unsichtbare Wächter am inneren Tor
Sie flüstern – aber sie wirken tief.
„Was, wenn ich sie damit verletze?“
„Ich will nicht egoistisch wirken.“
„Vielleicht hab ich überreagiert.“
Viele Frauen tragen eine chronische Form von Schuld in sich – nicht, weil sie etwas falsch gemacht haben,
sondern, weil sie sich verantwortlich fühlen, wo es eigentlich nicht ihre Aufgabe ist.
Diese Form von Schuld entsteht aus übergroßer Fürsorge.
Aus tief verinnerlichten Mustern, zum Beispiel:
„Ich bin dann gut, wenn ich für andere da bin.“
Echte Schuld fühlt sich anders an.
Sie ist klar.
Sie entsteht nach einem realen Fehlverhalten –
nicht nach der Fantasie, jemand könnte enttäuscht sein.
Die Frage lautet also:
Gehört diese Schuld wirklich mir?
Wenn du regelmäßig Schuld empfindest, obwohl du nichts falsch gemacht hast – dann ist es Zeit, hinzuschauen.
Und innerlich zu sagen:
„Ich darf meine Verantwortung zurücknehmen. Ich darf bei mir bleiben.“
4. Angst – die alte Freundin im neuen Gewand
Manchmal erscheint sie verkleidet.
Als Vorsicht. Als Grübeln. Als inneres Zögern.
Sie flüstert:
„Sag lieber nichts – das gibt nur Streit.“
„Halt dich lieber zurück – sonst wirst du abgelehnt.“
Viele Ängste sind nicht aktuell.
Sie stammen aus früheren Erfahrungen:
Der Wunsch, geliebt zu werden.
Nicht aufzufallen.
Nicht zu enttäuschen.
Angst ist jedoch kein Beweis, dass du etwas falsch machst.
Sie ist ein Hinweis, dass etwas wichtig ist.
Dass du an einer Schwelle stehst.
Du musst nicht angstfrei sein, um mutig zu sein.
Du musst nur aufhören, Angst mit Wahrheit zu verwechseln.
5. Emotionskompetenz stärken – was das konkret heißt
Emotionskompetenz heißt nicht: „Gefühle unter Kontrolle haben.“
Sondern: sich selbst kennen.
Psychologen wie Matthias Berking und Brian Whitley (2014) zeigen, dass emotionale Selbstregulation erlernbar ist – und langfristig zu mehr Klarheit, Resilienz neben Selbstbindung führt.
Hier drei erste Schritte:
1. Gefühle benennen – sag dir, was du fühlst.
Nicht: „Mir geht’s nicht gut.“
Sondern: „Ich bin enttäuscht. Ich bin erschöpft.“
Das schafft Distanz als auch Orientierung.
2. Körper lesen – wo spürst du dein Gefühl?
Enge im Hals? Ziehen im Bauch?
Der Körper spricht, bevor der Verstand es versteht.
3. Gefühle dürfen sein – nicht jedes Gefühl braucht eine Lösung.
Manches braucht nur Raum.
Und deine innere Erlaubnis:
„Ich darf das jetzt fühlen – ohne mich zu rechtfertigen.“
6. Du darfst fühlen, und trotzdem klar sein
Du musst nicht perfekt reagieren.
Nicht stark wirken. Nicht alles im Griff haben.
Du darfst fühlen –
und trotzdem führen.
Trotzdem entscheiden.
Trotzdem du sein.
Mit Wertschätzung für deine Grenzen
Sieglinde
P.S. Wenn du spürst, dass du oft zu lange schweigst, zu oft Ja sagst, und dich selbst dabei verlierst –
dann lade ich dich ein. In meinem kostenlosen Online-Training »Ich. Bin. Es. Mir. Wert.« gehen wir diesen Weg zusammen – mit klarer Sicht, viel Tiefgang und ohne Druck, dich selbst zu verbessern.
Du wirst merken: Du bist mit diesen Gefühlen nicht allein.
Sichere dir deinen Platz im Live-Online-Training:
sieglinderichter.at/workshop-ich-bin-es-mir-wert

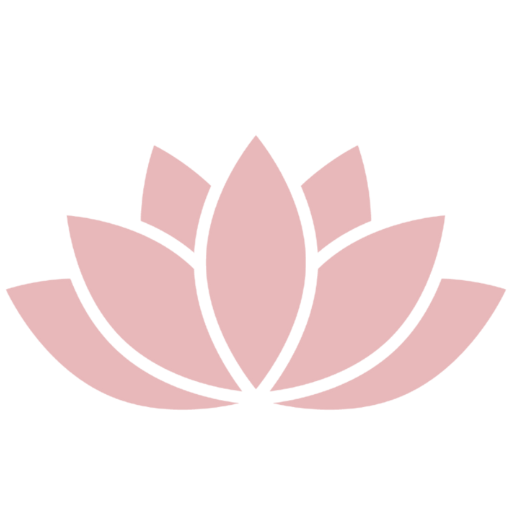
0 Kommentare