Das Wichtigste auf einen Blick
- Sensibilität im Beruf ist kein Zeichen von Schwäche. Sie ist vielmehr Ausdruck von Aufmerksamkeit und Vorsicht – ein inneres Frühwarnsystem, das dich vor unnötigen Konflikten und Fehlentscheidungen bewahren kann.
- Schweigen im Meeting oder im Gespräch bedeutet nicht mangelnder Mut, sondern ist häufig eine nachvollziehbare Schutzstrategie. Studien belegen, dass psychologische Sicherheit entscheidend dafür ist,
ob Menschen ihre Stimme erheben oder nicht. - Geschlechternormen wirken stark im Hintergrund: Frauen werden für dieselbe Durchsetzungskraft oft kritischer beurteilt als Männer. Dieses Muster erklärt, warum so viele erfolgreiche Frauen trotz Kompetenz zurückhaltend bleiben.
- Klare Kommunikation lässt sich trainieren. Mit fünf Prinzipien – kurz, klar, konsequent; Ich-Botschaften; wertschätzender Rahmen; Kontext und Konsequenz; Commitment-Fragen – gelingt es, Aussagen souverän und respektvoll zu platzieren.
- Wer regelmäßig kleine Schritte übt, baut nachhaltige Stärke auf. Schon kurze Trainings – wie die 10-Wort-Kernbotschaft, ein klares Nein oder eine wertschätzende Konfrontation – können das Selbstvertrauen spürbar erhöhen und die Angst vor Konsequenzen abbauen.
Diese Aussage trifft dich mitten ins Herz – und hinterlässt das Gefühl, etwas stimme nicht mit dir.
Doch Sensibilität ist keine Schwäche.
Sie ist eine Form von Wachsamkeit.
Eine innere Antenne, die Konflikte früh wahrnimmt und dich schützt, bevor etwas eskaliert.
Gerade Frauen in Führungspositionen oder mit hoher Verantwortung erleben diese Antenne oft doppelt stark.
Sie spüren Spannungen im Team, registrieren unausgesprochene Erwartungen – und wissen instinktiv, wann ein falsches Wort Konsequenzen haben könnte.
Das ist keine »Überempfindlichkeit«. Das ist kluge Vorsicht.
Psychologischer Hintergrund
Studien zeigen, dass Menschen in Arbeitsumfeldern mit wenig psychologischer Sicherheit ihre Meinung seltener äußern – aus Angst vor Ablehnung oder negativen Konsequenzen.
Dieses Schweigen aus Vorsicht ist kein persönliches Versagen, sondern eine nachvollziehbare Reaktion auf die Umgebung. Forschungen der letzten Jahre belegen, dass fehlende psychologische Sicherheit Stress, Burnout und Karrierehemmungen verstärkt, während ein sicheres Klima Mut und Innovationskraft fördert.
Deine Zurückhaltung ist also kein Zeichen von Schwäche – sondern eine Reaktion, die evolutionär und sozial Sinn ergibt.
Der innere Konflikt
Schon oft habe ich Frauen in verantwortungsvollen Positionen sagen gehört:
Dahinter steckt die Angst, als egoistisch oder unprofessionell wahrgenommen zu werden. Aber in Wahrheit ist die Fähigkeit, Bedenken zu äußern, ein Zeichen von Verantwortung und Weitsicht. Sie zeigt, dass du nicht nur mitarbeitest, sondern mitdenkst.
Perspektivwechsel
Anstatt deine Sensibilität klein zu reden, könntest du sie als Ressource sehen:
_Sie schützt dich davor, unüberlegt zu handeln.
_Sie hilft dir, feine Nuancen in Gesprächen wahrzunehmen.
_Sie macht dich zu einer Führungspersönlichkeit, die nicht nur entscheidet, sondern versteht.
Oder, wie eine Klientin es nach einer Sitzung formulierte:
Wissenschaftliche Befunde der letzten Jahre
Psychologische Sicherheit als Schlüssel: Teams, in denen sich Mitglieder sicher fühlen, ihre Meinung zu äußern, zeigen bessere Leistung und weniger Burnout.
Mehr Schweigen in unsicheren Kulturen: Fehlt psychologische Sicherheit, äußern Mitarbeitende ihre Bedenken seltener – nicht, weil sie „schwach“ sind, sondern weil die Umgebung gefährlich wirkt.
Gesundheitliche Folgen: Unsicherheit im Job korreliert mit Stress, Schlafproblemen und erhöhter Erschöpfung.
Deine Sensibilität ist also nicht übertrieben, sondern ein Signal: Hier stimmt etwas nicht im Umfeld.
2. Die Mechanik der Angst: psychologische Sicherheit vs. Schweigen
Warum schweigen so viele kluge Frauen in Meetings, obwohl sie etwas Wertvolles beizutragen hätten?
Nicht, weil ihnen die Argumente fehlen.
Sondern, weil das Risiko größer wirkt als der Nutzen.
Schweigen als Schutzstrategie
Forschung nennt dieses Phänomen »Defensive silence«. Dahinter steckt kein Desinteresse, sondern Selbstschutz: Die Angst, durch Widerspruch in Ungnade zu fallen, Kritik zu ernten oder gar als illoyal abgestempelt zu werden.
Gerade in hierarchischen Strukturen ist diese Angst real.
Frauen berichten zudem häufiger, dass sie beim Einbringen von kritischen Punkten schneller als emotional oder kompliziert abgestempelt werden. Dieses Muster ist nicht individuell, sondern systemisch.
Was Studien zeigen
_Mehr Burnout durch fehlende Sicherheit: Eine US-Studie aus 2024 belegt, dass Beschäftigte in Teams mit niedriger psychologischer Sicherheit signifikant häufiger Symptome von Burnout zeigen.
_Paradoxe Befunde: Eine systematische Übersichtsarbeit von 2025 zeigt: Mehr gemeldete Fehler in sicheren Teams bedeuten nicht mehr Fehler – sondern mehr Mut, Probleme offen anzusprechen.
_Stimme oder Schweigen? Organisationales Verhalten ist ein Balanceakt zwischen voice (etwas sagen) und silence (schweigen). Ob wir sprechen, hängt weniger von unserer Persönlichkeit ab – sondern davon, wie sicher der Raum ist.
Ein typisches Beispiel aus dem Alltag ist ein Projektmeeting.
Folgende Situation:
Deine Kolleg:innen präsentieren eine neue Strategie. Du bemerkst sofort, dass ein wichtiger Aspekt übersehen wurde. Doch statt es anzusprechen, beißt du dir auf die Zunge.
Warum?
Weil du dir denkst: »Wenn ich jetzt widerspreche, könnte das wie Kritik wirken. Vielleicht wirkt es besser, loyal zu nicken.«
Ergebnis: Das Team läuft in einen Fehler, der vermeidbar gewesen wäre – und du ärgerst dich, dass du nichts gesagt hast.
Die gute Nachricht
Psychologische Sicherheit ist trainierbar – sowohl in dir selbst als auch in Teams. Sie entsteht, wenn klar wird:
Kritik ist kein Angriff, sondern ein Beitrag. Schweigen ist kein Zeichen von Loyalität, sondern von Angst.
Studienbox (Auswahl, 2020–2024):
Psychological Safety – State of the Art: Annual Review (Edmondson & Bransby, 2023). Annual Reviews
PS → weniger Burnout / besseres Umfeld: Health Affairs Scholar, de Lisser et al., 2024. Oxford Academic
PS & Patientensicherheit (systematische Review, 2025): komplexe Zusammenhänge/Reporting. PMC
Voice & Silence (2022): Dynamik zwischen Sprechen und Schweigen am Arbeitsplatz (OBHDP). ScienceDirect
Assertiveness-Training (RCT, 2023): iCBT steigert adaptive Durchsetzung deutlich; Follow-up-Effekte.
Inklusive/Humble Leadership → PS → Voice (2024): Evidenz aus Feldstudien/Meta-Analysen. MDPISAGE Journals
3. »Darf ich das sagen?« – Wenn Geschlechternormen mitschreiben
Dein Herz schlägt schneller. Du überlegst, etwas zu sagen – aber plötzlich geht ein innerer Film los:
Was, wenn ich als rechthaberisch gelte?“
Kommt das zu hart rüber?“
Wenn ich das so direkt sage, bin ich wieder die, die zu viel will.“
Während dein Kollege mit fester Stimme weiterspricht, ringst du mit dir. Am Ende schluckst du deine Einwände herunter – und ärgerst dich noch Tage später darüber.
Backlash-Angst – ein unsichtbarer Gegner
Viele erfolgreiche Frauen kennen diese Situation. Sie zweifeln nicht an ihrer Kompetenz, sondern an der Reaktion des Umfelds. Studien zeigen: Frauen, die sich durchsetzungsstark äußern, werden häufiger als dominant oder unsympathisch wahrgenommen – während Männer für denselben Kommunikationsstil Anerkennung erhalten.
Das ist kein persönliches Problem, sondern Ausdruck gesellschaftlicher Geschlechternormen.
Und es erklärt, warum so viele Frauen bei wichtigen Themen verstummen, obwohl sie die Expertise haben.
Der Preis des Schweigens
_Deine Ideen bleiben ungehört.
_Du wirst unterschätzt – nicht, weil du weniger kannst, sondern weil du weniger sichtbar bist.
_Du fängst an, an dir selbst zu zweifeln – obwohl der Ursprung im System liegt, nicht in dir.
Perspektivwechsel
Was, wenn du dir erlaubst, die Rolle umzuschreiben? Was, wenn du jedes Mal, wenn du innerlich denkst »Darf ich das sagen?«, stattdessen fragst:
Denn dein Beitrag ist nicht nur legitim – er ist wertvoll. Und je öfter du sprichst, desto mehr gewöhnst du dir und deinem Umfeld an: Deine Stimme gehört dazu.
Studienbox: Gender & Kommunikation
Backlash-Effekt: Frauen, die durchsetzungsstark sprechen, werden häufiger negativer bewertet als Männer mit demselben Verhalten. (Rudman et al., Psychological Science in the Public Interest, 2020 Review)
Intersektionale Unterschiede: 2024 zeigte eine Studie im Administrative Science Quarterly, dass dominante Sprache bei Frauen je nach ethnischer Zugehörigkeit sehr unterschiedlich bewertet wird – ein Hinweis auf Mehrfachdiskriminierung.
Langfristige Folgen: Wer schweigt, um Backlash zu vermeiden, hat langfristig geringere Chancen auf Beförderung und weniger Einfluss im Team. (Cortina & Berdahl, Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 2023)
4. Was wirklich hilft: evidenzbasierte Hebel für deine Stimme
Wenn wir uns fragen, warum manche Menschen selbstverständlich Gehör finden, während andere übergangen werden, liegt die Antwort nicht nur in der Persönlichkeit.
Forschung zeigt: Ob wir sprechen oder schweigen, hängt stark von den Bedingungen im Umfeld ab – und von ganz konkreten Verhaltensweisen, die trainierbar sind.
5 Hebel, die deine Stimme stärken
1. Mikro-Mut trainieren
Studien belegen: Voice – also das Einbringen von Ideen – ist kein Alles-oder-nichts, sondern ein dynamischer Prozess. Schon kleine Wortmeldungen senken die Schwelle fürs nächste Mal.
Praxis: Starte im Meeting mit einer kurzen Rückfrage oder Zustimmung. Dein Nervensystem lernt:
2. Psychologische Sicherheit aktiv suchen und schaffen
2024 zeigten Feldstudien: Inklusive oder humble Leadership steigert nachweislich die psychologische Sicherheit – und damit die Bereitschaft, die eigene Meinung einzubringen.
Praxis: Suche dir Verbündete, die deine Beiträge sichtbar unterstützen. Und wenn du selbst leitest: Stelle Fragen wie
3. Voice mit relational accounts verbinden
Eine starke Strategie gegen Widerstand: Verbinde deine Botschaft mit dem Nutzen für andere. Forschung zeigt, dass Aussagen, die sich auf Teamziele beziehen, weniger Abwehr auslösen.
Praxis: Statt»Das halte ich für falsch.« → »Damit wir das Ziel X erreichen, wäre dieser Punkt wichtig.«
4. Timing & Ritual nutzen
Untersuchungen zeigen: Wer feste Momente zum Sprechen hat (z. B. Feedbackrunden), ergreift die Stimme häufiger und angstfreier.
Praxis: Nutze offizielle Feedbackrunden oder vereinbare mit deinem Team einen festen Check-in, in dem jede Stimme zählt.
5. Selbstregulation als Basis
Ein RCT aus 2023 fand, dass assertive Kommunikation durch kognitive Verhaltenstrainings signifikant gesteigert werden kann – auch weil Betroffene lernten, körperliche Stresssignale zu regulieren.
Praxis: Vor deiner Wortmeldung: einmal bewusst ausatmen, die Schultern lockern, dann sprechen. Dein Körper signalisiert dir: »Ich bin sicher.«
Studienbox: evidenzbasierte Hebel für Voice
Voice & Silence als dynamischer Prozess: Detert & Burris, OBHDP, 2022.
Inklusive/humble Leadership → mehr psychologische Sicherheit → mehr Voice: Zhang et al., Journal of Applied Psychology, 2024.
Relationale Begründungen mindern Widerstand: Grant, AMJ, 2021.
Strukturiertes Feedback fördert Beteiligung: Liang et al., Human Relations, 2022.
Assertiveness-Training steigert Kommunikation: Sakurai et al., Cognitive Behaviour Therapy, 2023.
5. Assertiveness ≠ Härte: Selbstbewusst statt hart – so klingt’s
Viele Frauen verwechseln selbstbewusst auftreten mit hart und kompromisslos sein.
Kein Wunder – oft erleben wir im beruflichen Umfeld vor allem zwei Extreme: Entweder Menschen, die gar nichts sagen, oder solche, die mit Druck auftreten.
Doch assertive Kommunikation liegt dazwischen: klar, respektvoll, und trotzdem bestimmt.
Beispiel 1 – Projektaufgabe ablehnen
Passiv:
»Ähm … ich weiß nicht, vielleicht könnte ich das noch übernehmen, wenn’s unbedingt sein muss.«
Aggressiv:
»Das ist doch nicht mein Job – warum schiebt ihr mir das schon wieder zu?!«
Assertiv:
»Ich schätze Ihr Vertrauen. Gleichzeitig habe ich aktuell volle Kapazität und kann diese Aufgabe nicht übernehmen.
Damit die Qualität stimmt, sollte sie jemand anderes übernehmen.«
Klar, wertschätzend, ohne Entschuldigung – aber auch ohne Angriff.
Beispiel 2 – Unterbrechung im Meeting
Passiv:
»… äh, nein, mach nur weiter, ist schon okay.«
Aggressiv:
»Können Sie bitte aufhören, mir ständig ins Wort zu fallen?«
Assertiv:
»Einen Moment bitte – ich möchte meinen Gedanken noch zu Ende führen. Danach höre ich gern Ihre Sicht.«
Selbstbewusst, aber mit Einladung zum Dialog.
Beispiel 3 – Verhandlungsgespräch
Passiv:
»Also, wenn das Gehalt so bleibt, ist es schon auch okay …«
Aggressiv:
»Wenn ich diese Erhöhung nicht bekomme, bin ich weg.«
Assertiv:
»Meine Verantwortung hat sich in den letzten Monaten deutlich erweitert. Deshalb möchte ich über eine Gehaltsanpassung sprechen, die das widerspiegelt.«
Die Botschaft bleibt klar, ohne Drohung oder Beschwichtigung.
6. Die 5 Kommunikations-Prinzipien für klare, respektvolle Statements
Es gibt keinen Zaubersatz, der jede Situation löst. Aber es gibt Grundprinzipien, die dich sofort souveräner wirken lassen – egal ob im Meeting, im Gespräch mit Vorgesetzten oder privat.
1. Kurz. Klar. Konsequent.
Weniger Worte = mehr Wirkung.
Beispiel: Statt »Ich glaube, ich könnte vielleicht helfen, wenn es nicht zu viel Aufwand ist …«
→ »Ich kann dieses Projekt nicht übernehmen.«
2. Ich-Botschaft+
Rede von dir, nicht über den anderen. Das verhindert, dass dein Gegenüber sofort in Abwehrhaltung geht.
Beispiel: Statt »Du hörst nie richtig zu«
→ »Mir ist wichtig, dass ich meinen Gedanken fertig aussprechen kann.«
3. Wertschätzender Rahmen
Kritik verliert ihre Schärfe, wenn sie in einen respektvollen Kontext eingebettet ist.
Beispiel: Statt »Das macht so keinen Sinn«
→ »Ich sehe den Einsatz, der hier drin steckt – gleichzeitig fehlt mir noch die Perspektive X.«
4. Kontext & Konsequenz
Mach klar, warum dein Beitrag wichtig ist – und was passiert, wenn er fehlt.
Beispiel: »Wenn wir diesen Punkt nicht berücksichtigen, riskieren wir Verzögerungen im Projekt. Mein Vorschlag ist, XY gleich mitzudenken.«
5. Commitment-Fragen
Statt Ultimaten: Einladungen. Sie öffnen den Dialog und zeigen Führungsstärke.
Beispiel: »Sind Sie bereit, dass wir diese Aufgabe priorisieren und andere dafür verschieben?«
Diese fünf Prinzipien sind wie ein innerer Kompass. Sie helfen dir, dich weder zu verlieren noch andere vor den Kopf zu stoßen. Und je öfter du sie übst, desto mehr werden sie zu deiner neuen, natürlichen Sprache.
Studienbox: Kommunikation, die wirkt
Relationale Accounts reduzieren Widerstand: Aussagen, die an Teamziele gekoppelt sind, werden seltener abgewehrt. (Grant, Academy of Management Journal, 2021)
Strukturierte Kommunikation senkt Stress: Frauen, die klare Ich-Botschaften trainierten, berichteten von weniger Konfliktangst. (Sakurai et al., Cognitive Behaviour Therapy, 2023)
Commitment-Fragen fördern Kooperation: Forschung zeigt, dass offene Fragen zu höherer Bereitschaft führen, Verantwortung zu teilen. (Liang et al., Human Relations, 2022)
7. Deine Tool-Box: sofort nutzbare Formulierungen & Vorlagen
Manchmal fehlt uns im entscheidenden Moment nicht der Mut – sondern die Worte. Diese kleine Tool-Box gibt dir sofort einsetzbare Formulierungen, die dir Sicherheit geben und dich gleichzeitig respektvoll wirken lassen.
1. Die »10-Wort-Kernbotschaft«
Halte deine Hauptaussage so knapp, dass sie in maximal zehn Wörter passt.
Beispiel: »Ich habe volle Kapazität und kann diese Aufgabe nicht übernehmen.«
2. Die »NEIN-Formel«
Drei Schritte, die dir helfen, klar Grenzen zu ziehen – ohne Schuldgefühle:
1.Wert anerkennen → »Danke, dass Sie an mich gedacht haben.«
2.Grenze benennen → »Ich habe aktuell keine Kapazität.«
3.Alternative anbieten → »Vielleicht kann Kollegin X unterstützen.«
3. Widerspruch ohne Angriff
Beispiel: »Ich sehe das anders. Aus meiner Sicht sollten wir XY berücksichtigen.«
Klar, respektvoll, ohne das Gegenüber klein zu machen.
4. Meeting-Einstieg mit Sicherheit
Beispiel: »Ich möchte kurz meine Perspektive ergänzen, bevor wir weitergehen.«
Du verschaffst dir Raum, ohne dich zu rechtfertigen.
5. E-Mail ohne Weichzeichner
Viele Frauen schwächen ihre Botschaften unbewusst ab – durch Wörter wie »nur«, »kurz«, »eigentlich«.
Vorher: »Ich wollte nur kurz fragen, ob Sie vielleicht Zeit hätten …«
Nachher: »Ich möchte Sie um ein Gespräch nächste Woche bitten.«
Nutze diese Vorlagen als Gerüst. Passe sie an deine Sprache an – und du wirst merken: Je öfter du klare Formulierungen übst, desto natürlicher klingen sie.
8. Schwierige Situationen souverän meistern
Selbstbewusst kommunizieren heißt nicht, dass es immer leicht ist. Gerade in herausfordernden Momenten braucht es Klarheit und Ruhe. Hier findest du vier typische Szenarien – und Formulierungen, die dich sicher durchtragen.
1. Wortmeldungen im Meeting
Du möchtest etwas sagen, hast aber das Gefühl, nicht »dranzukommen«.
Beispiel: »Ich möchte kurz meine Sicht ergänzen, bevor wir zum nächsten Punkt gehen.«
Kurz, klar, nicht entschuldigend.
2. Unterbrechungen stoppen
Jemand fällt dir mitten ins Wort.
Beispiel: »Einen Moment bitte – ich möchte meinen Gedanken noch abschließen.«
Bestimmt, aber ohne Angriff.
3. Nein zur Zusatzarbeit
Eine Kollegin bittet dich, kurzfristig eine Aufgabe zusätzlich zu übernehmen.
Beispiel: »Ich verstehe, dass es dringend ist. Gleichzeitig habe ich meine Kapazitäten ausgeschöpft und kann das nicht übernehmen.«
Wertschätzend, aber konsequent.
4. Wenn die Reaktion frostig wird
Du hast deine Meinung geäußert – und spürst Ablehnung oder Stille.
Beispiel: »Ich merke, dass mein Punkt vielleicht überraschend war. Mir ist wichtig, dass wir ihn trotzdem gemeinsam bedenken.«
Du nimmst die Spannung wahr, bleibst aber bei deiner Botschaft.
In solchen Momenten geht es nicht darum, perfekt zu sein. Sondern darum, deine Stimme nicht zurückzuziehen, wenn es schwierig wird. Je öfter du das übst, desto leichter wird es dir fallen.
9. Für Führungskräfte & Projektleiterinnen: Wie du »Voice« in deinem Team kultivierst
Als weibliche Führungskraft kennst du die doppelte Herausforderung:
Du sollst souverän entscheiden – und gleichzeitig empathisch führen.
Beides ist kein Widerspruch.
Im Gegenteil: Deine Fähigkeit, psychologische Sicherheit zu schaffen, ist einer der stärksten Hebel für die Leistung deines Teams.
Hier eine Checkliste, die dir hilft, deine Meetings und Zusammenarbeit so zu gestalten, dass alle Stimmen gehört werden:
Deine Checkliste für psychologische Sicherheit im Team
1. Sprich Einladungen klar aus
Statt darauf zu warten, dass sich alle von selbst melden:
»Welche Sicht fehlt uns noch?« oder »Was denkt ihr, könnte hier noch zum Risiko werden?«
2. Normalisiere Fehler
Sag offen, wenn du selbst etwas übersehen hast.
Das signalisiert: Hier ist es erlaubt, unperfekt zu sein.
3. Schaffe Rituale für Feedback
Baue fixe Runden ein, in denen jede Person kurz ihre Sicht teilt.
So verhinderst du, dass nur die Lautesten zu Wort kommen.
4. Belohne den Mut, nicht nur das Ergebnis
Danke explizit für das Einbringen einer kritischen Stimme – auch wenn du anderer Meinung bist.
5. Stoppe Unterbrechungen sofort
Unterbricht jemand eine Kollegin, greif ein:
»Lass uns bitte erst den Gedanken von Anna zu Ende hören.«
6. Fördere Commitment-Fragen
Ermutige dein Team, ihre Beiträge mit einer Einladung abzuschließen:
»Wie seht ihr das?« – das öffnet statt zu blockieren.
7. Sei sichtbar ansprechbar
Halte kurze 1:1-Sprechzeiten offen, in denen auch leise Stimmen Gehör finden.
Aktuelle Studien zeigen: Inclusive und »humble« Leadership – also eine Haltung von Zuhören, Interesse und Lernbereitschaft – steigern die psychologische Sicherheit im Team und damit die Innovationskraft. Und gerade Frauen in Führungsrollen haben hier oft eine besondere Stärke: Sie verbinden klare Ansprüche mit Beziehungsorientierung.
Studienbox: Leadership & Psychologische Sicherheit
Annual Review 2023: Psychologische Sicherheit gilt als zentraler Faktor für Teamleistung und Mitarbeiter:innenbindung. (Edmondson & Bransby, AROP/OB, 2023)
Unterbrechungen im Meeting: Wer als Leitung bewusst Raum sichert, verhindert systematische Ungleichheiten. (Karpowitz & Mendelberg, APSR, 2021)
10. 7-Tage-Training: Mini-Übungen für starke Stimme & ruhige Nerven
Manchmal braucht es keinen großen Kurs, sondern kleine, wiederholte Schritte. Dieser Wochenplan gibt dir jeden Tag eine Mini-Challenge – damit du deine Stimme trainierst, ohne dich zu überlasten.
Tag 1 – Atem + Pause
Nimm dir heute 3 x eine Minute, um bewusst zu atmen: Einatmen 4 Sekunden, ausatmen 6 Sekunden.
Dein Nervensystem lernt: »Ich bin sicher.«
Tag 2 – 10-Wort-Kernbotschaft
Formuliere deine wichtigste Botschaft des Tages in maximal zehn Wörtern.
Beispiel: »Mein Fokus liegt heute auf Projekt X – anderes hat Priorität B.«
Tag 3 – Ein klares Nein
Sag heute bewusst einmal Nein – freundlich, aber bestimmt.
»Danke für die Anfrage, ich kann das heute nicht übernehmen.«
Tag 4 – Eine wertschätzende Konfrontation
Wähle eine kleine Situation, in der du deine Meinung sagst – und dabei Respekt betonst.
»Ich sehe deinen Einsatz, gleichzeitig möchte ich noch diesen Aspekt ergänzen.«
Tag 5 – Der Bauch-Test
Übe bei einer Anfrage bewusst den »Bauch-Test«: Stelle dir vor, du sagst Ja. Spür in dich hinein – engt es dich ein?
Dann ist es Zeit für ein Nein.
Tag 6 – Meeting-Mikroeinwurf
Mach heute im Meeting mindestens einen kurzen Einwurf.
»Darf ich kurz ergänzen …« – auch kleine Wortmeldungen zählen!
Tag 7 – Selbstmitgefühl im Rückblick
Am Abend: Schreibe drei Sätze, die dir gutgetan hätten, hättest du sie von einer Freundin gehört. Lies sie dir laut vor.
Beispiel: »Du hast deine Stimme heute eingesetzt. Du bist mutig. Du darfst stolz sein.«
Diese sieben Übungen sind klein – aber sie wirken, wenn du sie regelmäßig wiederholst. Dein Nervensystem gewöhnt sich daran, dass deine Stimme nicht gefährlich, sondern wertvoll ist.
Mit Wertschätzung für deine Grenzen
Sieglinde

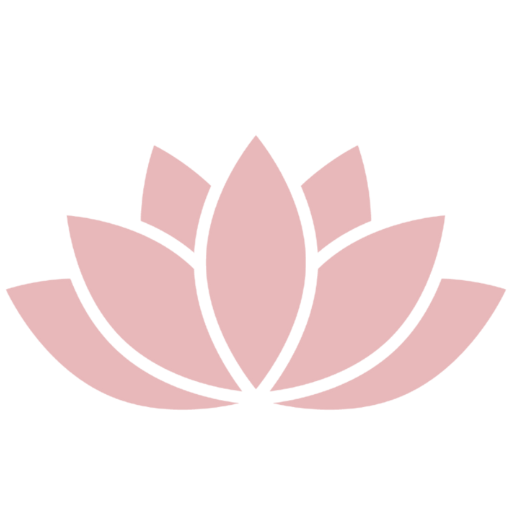
0 Kommentare